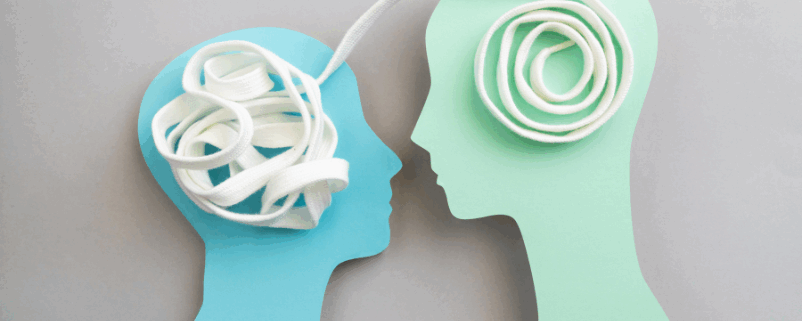Was ist die Polyvagaltheorie?
Die Polyvagaltheorie ist ein körper- und beziehungsorientierter Ansatz, dieser wurde von Dr. Stephen Porges gegründet. Diese Theorie beschreibt, wie unser autonomes Nervensystem auf Sicherheit oder Bedrohung reagiert – nicht nur in Extremsituationen, sondern ständig, auch im Alltag.
Im Zentrum steht der Vagusnerv – ein zentraler Bestandteil des parasympathischen Nervensystems. Der Vagus ist wie ein inneres Alarmsystem, das blitzschnell entscheidet, ob wir uns sicher fühlen, kämpfen, fliehen oder uns zurückziehen. Die Polyvagaltheorie erklärt dabei, dass unser Nervensystem drei Reaktionsmodi kennt:
Soziale Verbindung (ventraler Vagus): Wir fühlen uns sicher, offen, verbunden.
Kampf oder Flucht (Sympathikus): Wir sind in Alarmbereitschaft, reagieren mit Wut, Anspannung oder Fluchtimpuls.
Erstarrung oder Rückzug (dorsaler Vagus): Wir fühlen uns überfordert, taub, handlungsunfähig oder innerlich abgeschnitten.
Die Polyvagaltherapie nutzt dieses Wissen, um therapeutisch nicht gegen Symptome zu kämpfen, sondern das Nervensystem darin zu unterstützen, sich wieder sicher zu fühlen – und damit heilende Prozesse überhaupt erst zu ermöglichen.
Welche Bedeutung hat sie in zwischenmenschlichen Beziehungen?
Beziehung beginnt im Nervensystem – lange bevor wir ein Wort sagen.
Ob wir in Verbindung gehen oder uns verschließen, ob wir Vertrauen spüren oder uns bedroht fühlen: All das wird nicht bewusst entschieden, sondern vom autonomen Nervensystem gesteuert. Und genau hier liegt der Schlüssel: Die meisten Konflikte in Partnerschaft, Familie oder beruflichem Kontext entstehen nicht, weil jemand „zu viel“, „zu laut“, „zu bedürftig“ oder „zu kalt“ ist – sondern weil sich zwei Nervensysteme gegenseitig nicht mehr sicher erleben.
Die Polyvagaltherapie hilft, diese Dynamiken zu verstehen – und eröffnet neue Möglichkeiten, damit umzugehen:
Wir erkennen Schutzreaktionen als sinnvoll – nicht als Feind.
Wir lernen, Stressmuster zu entschlüsseln, statt uns selbst oder andere dafür abzuwerten.
Wir stärken die Fähigkeit zur Co-Regulation – also zur gegenseitigen Beruhigung und Verbindung.
Wir erleben, wie Sicherheit entsteht – im Kontakt, im Körper, im Hier und Jetzt.
Gerade in der Paartherapie oder in zwischenmenschlicher Begleitung ist dieses Wissen goldwert: Plötzlich ergibt scheinbar unlogisches Verhalten Sinn – und statt Schuld oder Ohnmacht entsteht Mitgefühl und ein neues Handlungsrepertoire.
Und in der Therapie?
In der therapeutischen Begleitung bedeutet Polyvagaltherapie, den Zustand des Nervensystems mitzudenken – und gezielt Räume zu schaffen, in denen Sicherheit, Regulierung und Verbindung möglich werden. Dazu gehört:
ein achtsames Tempo, das das Nervensystem nicht überfordert,
der Einbezug von Körperwahrnehmung und Atem,
der bewusste Aufbau von Ressourcen und Regulationserfahrungen,
die Unterstützung, innere Zustände zu benennen und zu verstehen – ohne Druck, ohne Pathologisierung.
So wird Therapie nicht zu einem Ort des Funktionierens, sondern zu einem Ort, an dem echte Integration geschehen kann.
Fazit
Die Polyvagaltherapie bringt eine tiefe Erkenntnis in unser Menschenbild:
Wir verhalten uns nicht „schwierig“, weil wir so sind – sondern weil wir Schutz brauchen.
Wer das Nervensystem versteht, versteht den Menschen neu.
Und wer Beziehung durch diese Linse betrachtet, entdeckt:
Hinter Rückzug, Wut oder Kontrolle steckt oft ein einziger Wunsch – Sicherheit.